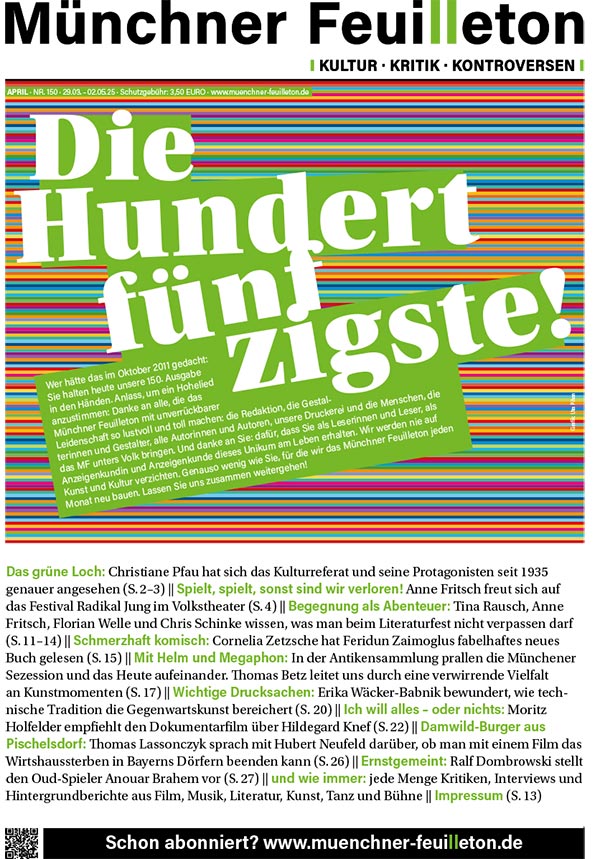Die Schauspielerin und Sängerin Hildegard Knef zählt zu den großen Stars der deutschen Nachkriegszeit. Der Dokumentarfilm »Ich will alles. Hildegard Knef« erzählt von ihrem Leben und besticht vor allem durch sein grandioses Archivmaterial.
Ich will alles. Hildegard Knef
Ein zerrissenes Künstlerleben

»Ich rauche noch die letzte Zigarette und leg noch mal die alte Platte auf«, singt Hildegard Knef | © Privatarchiv Hildegard Knef
Vor 23 Jahren starb sie in Berlin. Ein gutes halbes Jahr später, im Dezember 2002, gab die Deutsche Post im Rahmen der Serie »Frauen der deutschen Geschichte« eine Sonderbriefmarke mit dem postalischen Porträt der Künstlerin heraus. Hildegard Knef als junge Frau. Klar zu erkennen sind auf der feinen Schwarz-Weiß-Zeichnung die großen wässrigen Augen der Schauspielerin und Sängerin. Immer waren sie auf der Bühne mit Kajal gerahmt, den für sie so typischen schwarzen Lidstrichen, ober- und unterhalb der Augen kräftig aufgetragen, fast so, als würde sie eine Zorro-Maske tragen. Auch die Schweizer Regisseurin Luzia Schmid zeigt in ihrem Dokumentarfilm immer wieder diese faszinierenden Augen, anfangs mit Archivbildern eines Konzertmitschnitts Ende der 1960er Jahre.
Die Knef singt ihr berühmtestes Lied »Für mich soll’s rote Rosen regnen« , früher Kultsong der Schwulen in Deutschland und stilisierter »Lebensabriss en miniature« , wie ihn Knefs Biograf Christian Schröder einmal nannte. Die Knef betritt in einem schwarzen Glitzerkleid die Bühne, sie verneigt sich, das Orchester setzt ein, dann ihre Stimme: »Mit 16, sagte ich still, ich will. Will groß sein, will siegen. Will froh sein, nie lügen. Mit 16, sagte ich still, ich will. Will alles oder nichts.« Die Kamera zoomt sich langsam in das Gesicht der Knef hinein – und wenn die stimmlich bei den roten Rosen ankommt, die es für sie regnen soll, zeigt die Leinwand nur noch ihre Augen: »Mir sollten sämtliche Wunder begegnen.« Ein großartiger Beginn, sofort ist man voll drin in diesem zerrissenen Künstlerleben. Und so geht es weiter. Nächster Auftritt. Technische Probe. Ein Lautsprecher pfeift. Eine Rückkoppelung. »Der ist oben« , sagt die Knef, »der da pfeift«, und deutet mit einer Hand in den Bühnenhimmel. Und wieder saugt sich die Kamera an ihren Augen fest. So könnte es immer weitergehen – schnell ist klar: Dieser Dokumentarfilm lebt vor allem von seinem grandiosen Archivmaterial. Zu den Bildern aus vergangenen Zeiten liest die Schauspielerin Nina Kunzendorf gelegentlich Ausschnitte aus autobiografischen Texten der Knef: »Wie war Dein Leben? Wie wird meins? Was soll ich tun, was soll ich lassen? Wann soll ich lieben, wann soll ich hassen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.«
Die Knef – eine Künstlerin, die ihr fragiles schwankendes Inneres immer wieder kenntlich macht, ihre Unsicherheit, ihre Gedanken, ihre Krisen, bisweilen auch ihr Glück. »Manchmal habe ich Angst, erkannt zu werden; dann wieder habe ich Angst, nicht erkannt zu werden.« Groß im Bild – die Augen. »Ich will den Erfolg und wehre mich.« Ambivalenzen, die der Film in der Montage der Bilder sanft rhythmisiert – dem gibt man sich als Zuschauer gerne hin, diesem feinen Mäandern zwischen widersprüchlichen Gefühlen. Da bräuchte es dann gar nicht die Interviewsequenzen mit Hildegard Knefs Tochter Christina, geboren im Mai 1968 in München. Damals, im Alter von 42 Jahren, hatte die Mutter bereits eine große Karriere hinter sich. Schauspielausbildung bei der UFA, danach Rollen in wegweisenden Filmen wie Helmut Käutners »Unter den Brücken …« und »Die Mörder sind unter uns«. Im August 1948 erschien sie auf der Titelseite der ersten Ausgabe der Illustrierten »Stern« als der große deutsche Nachkriegsstar. Bald lockte Hollywood, die Knef unterschrieb in der Traumfabrik mit Produzent David O. Selznick einen Siebenjahresvertrag. 1950 wurde sie US-Staatsbürgerin. Im gleichen Jahr spielte sie in Deutschland in Willi Forsts »Die Sünderin« die Prostituierte Marina. Als Aktmodell für ihren Freund, den Maler Alexander, ist sie für sechs Sekunden auf der Leinwand nackt zu sehen. »Die Sünderin« zierte monatelang die Titelseiten von Zeitungen und Zeitschriften. Es gab Boykottaufrufe, Demonstrationen und Aufführungsverbote.
»Ich will alles – oder nichts.« Das singt die Knef am Ende des Dokumentarfilms von Luzia Schmid erneut, ein paar Jahre älter und um ein paar Erfahrungen reicher. Die Stimme der passionierten Raucherin klingt lebenserfahrener, nicht mehr ganz so frisch. 1980 unterzieht sie sich, nachdem sie unzählige Operationen wegen ihrer Krebserkrankung über sich ergehen lassen musste, auch noch freiwillig einer kosmetischen Operation. In einer Talkshow wird sie gefragt: Warum? Und sie, durchaus erfüllt von einem emanzipatorischen Geist, antwortet trocken selbstkritisch und dabei die ungeschriebenen Gesetze des Showbusiness benennend: »Die Emanzipation hat eben nicht wirklich stattgefunden. Gerade in meinem Beruf wird Zeitlosigkeit verlangt. Ich habe nun nicht vor, 18-Jährige zu spielen oder mich zu verändern. Aber die Zeitlosigkeit wird abverlangt. Ein gewisser Glamour, etwas Unveränderbares, das von Männern nie verlangt wird.«
Ober- und Unterlider werden gestrafft, Tränensäcke beseitigt, die Oberlippe angehoben, die Haut glatt gezogen. In Illustrierten, zu sehen auch im Film, gibt es Vorher-Nachher-Bilder der Knef. Ein damaliger Freund, der Showmaster Blacky Fuchsberger, befragt sie im Fernsehen und meint ironisch, es sei wunderbar, ein neues Gesicht präsentieren zu können. Die Knef macht alles mit – nie eitel oder kokett, sondern erstaunlich offen, ehrlich, pragmatisch. »Hat es wehgetan?«, fragt Fuchsberger, und sie antwortet charmant verbindlich, ganz kurz: »Ja.« Die Höhen und Tiefen ihres Lebens stellt sie nicht glamourhaft aus, sondern erzählt von ihnen so klug wie nüchtern und scheint immer alle, die ihr zuhören, miteinbeziehen zu wollen. Gefühle inszeniert sie nicht für Menschen mit voyeuristischer Wissbegier, sondern als Seelenzustände, die jede und jeder kennt. Schaut her – mir geht es auch nicht anders als euch. Aber wenn wir uns gegenseitig zuhören und versuchen, uns zu verstehen, wird das Leben ein besseres sein.
1986 unternimmt Hildegard Knef ihre letzte Tournee. Auf der Bühne kommen ihr beim Abschied die Tränen. Danach veröffentlicht sie weiter Schallplatten und ist als Künstlerin wie als Privatperson immer noch »voll drin«. Zwei Wochen nach ihrem letzten Talkshowauftritt stirbt Hildegard Knef an einer Lungenentzündung. Wie heißt es in Lied und Film? »Ich kann mich nicht fügen. Kann mich nicht begnügen. Will immer noch siegen. Will alles, oder nichts.« ||
ICH WILL ALLES. HILDEGARD KNEF
Deutschland 2025 | Buch & Regie: Luzia Schmid | Mit Christina Palastanga, Paul von Schell und der Stimme von Nina Kunzendorf | 90 Minuten | Kinostart: 3. April | Website | City Kinos | 30. März | 16 Uhr | Publikumsgespräch mit Regisseurin Luzia Schmid
Weitere Kritiken finden Sie in der aktuellen Ausgabe. Hier geht es zum Kiosk.
Das könnte Sie auch interessieren:
Christof Weigold: Ein Spaziergang mit dem Hardy Engel-Autoren
Mit Liebe und Entschlossenheit: Der neue Film von Claire Denis
DOK.fest 2024: Ein Blick ins Programm
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!
Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.
Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.
JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton