Ein Gespräch mit Carolin Emcke anlässlich des Erscheinens ihres Pandemie-Tagebuchs. Über das Dokumentieren einer unsicheren Gegenwart, fehlende Verbindungen und das ängstliche Zögern der Politik.
Carolin Emcke:
»Lust auf radikale Veränderungen«

Carolin Emcke | © Andreas Labes
Im März 2020 fängt Carolin Emcke an, ein Corona-Tagebuch zu schreiben. Damals war die Pandemie gerade ausgebrochen, niemand ahnte, was noch alles kommen würde. Nun, da ihr »Journal« erschienen ist, ist ein Ende noch immer nicht in Sicht, wohl aber die umfassenden Auswirkungen von Covid-19. Vieles erscheint beim Lesen weit weg, wie ein Blick zurück in die eigene Ahnungslosigkeit.
Erinnern Sie sich noch, wann Sie das erste Mal von Corona hörten?
Ja, das war im Dezember 2019 oder Januar 2020. Ich weiß noch, dass ich meiner Freundin erzählt habe, dass es da eine noch unbekannte Lungenerkrankung gäbe und mir das ausgesprochen gefährlich klänge. Ich habe ihr noch gesagt, sie solle das lieber gar nicht erst lesen, weil es angsteinflößend sei.
Wann ahnten Sie, dass diese Krise eine globale werden könnte, die unser aller Leben verändert?
Also die »Ahnung« war tatsächlich schon sehr früh da. Wie tief es in unser Leben eingreift und was es alles an Folgen nach sich zieht, das holt mich immer noch jeden Tag ein. Tag für Tag werden die Umwälzungen, die es global noch nach sich ziehen wird, deutlicher.
Ihr »Journal« setzt genau heute vor einem Jahr ein, am 23. März 2020, und reicht bis in den Mai 2020. Aus welchem Impuls fingen Sie damals an, die Ereignisse zu dokumentieren?
Mir war klar, dass dies ein wirklich historischer Einschnitt sein würde. Etwas für unsere Generation nie Dagewesenes. Da war sofort der Impuls, es zu beschreiben und zu reflektieren, mit allem, was dabei vielleicht irrtümlich oder voreilig oder falsch sein würde – weil es später wichtig sein kann, so eine Perspektive in Echtzeit zu haben.
Die Form des Tagebuchs macht dieses Verwurzeltsein in der Zeit sichtbar. Max Frisch hat es in seinem Tagebuch so ausgedrückt: »Indem man es nicht verschweigt, sondern aufschreibt, bekennt man sich zu seinem Denken, das bestenfalls für den Augenblick und den Standort stimmt, da es sich erzeugt.« Ein Journal dokumentiert die Entwicklung der Erkenntnis.
Ja. Genau. Beim Tagebuch-Schreiben muss man zulassen, dass es nicht endgültig sein kann, man darf nicht Angst haben vor dem späteren Urteil derer, die mehr wissen. Es ist ein sehr brüchiges, poröses Schreiben, das jeden Tag auch neu entscheidet, wohin sich der Blick richtet: ins Innen oder ins Außen. Bei mir war mit der Zeit das Rausgehen sehr wichtig, das Andere-Orte-, Andere-Ereignisse-, Andere-Kontexte-Aufsuchen. Den erzwungenen Autofokus aufzubrechen.
Sie sind dann wie so viele andere spazieren gegangen. Wenn sich der räumliche Radius verengt, blickt man dann mit neuen Augen auf die gewohnte Umgebung?
Beim Spazierengehen ist vor allem die Melancholie gewachsen, was alles verschwinden, nie wieder öffnen wird. Und gleichzeitig ist das Fernweh wirklich schmerzlich geworden.
Die Texte sind eine hybride Mischung aus Zitaten, Beobachtungen, persönlichen Erlebnissen und politischen Betrachtungen. Es gibt Begebenheiten in der Nähe wie die Familie, die von der Straße hoch zum Opa im Altenheim schreit, vergebens versucht, die Distanz zu überbrücken. Und immer wieder den Blick in die Welt, als »Korrektiv für die Weinerlichkeit«, wie Sie bei der Online-Buchpremiere in der Berliner Schaubühne sagten.
Das Tagebuch ist als Genre besonders geeignet für eine so tiefgreifende Krise, weil es alles erlaubt, das Subjektive, das Intime, aber auch das Politische, die permanenten Veränderungen der Brennweite, das entspricht eben dem, wie diese Pandemie eingreift in unsere Welt, aber auch in unsere Körper, unsere Gesten, unsere Beziehungen.
Welchen dieser Eingriffe haben Sie in Ihrem persönlichen Alltag als besonders schwerwiegend erlebt?
Die Kontaktbeschränkung auf einen anderen Haushalt. Das zieht so ein Verbürgerlichen nach sich, weil man nicht mehr viele Menschen auf einmal sehen kann. Das Anti-Soziale darin wurde mit der Zeit immer bedrohlicher.
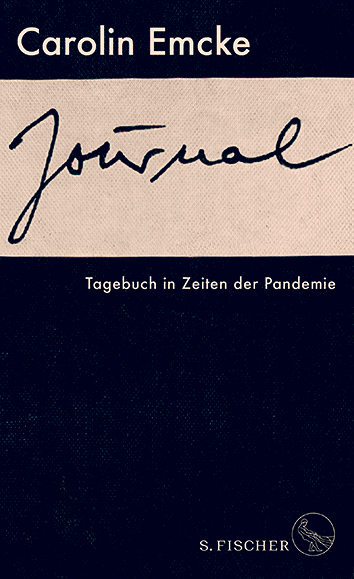
Einige Menschen im Kulturbetrieb haben die Zwangspause zunächst einmal als willkommene Verschnaufpause erlebt, als Gelegenheit, jahrelang für selbstverständlich erachtete Arbeitsstrukturen und Produktionszwänge zu hinterfragen. Ging Ihnen das auch so?
Nein. Wirklich nicht. Ich hatte schon vorher einen recht guten Rhythmus aus Innehalten, Disruptionen, Schreibklausuren und Phasen des Unterwegsseins und der Öffentlichkeit. Mir fehlt wirklich das, was Kae Tempest in ihrem neuen Buch »Verbindung« nennt. Die Verbindung zu anderen, in einem Theater, einem Club, auf der Straße.
Die Tagebucheinträge wurden Woche für Woche in der »Süddeutschen Zeitung« veröffentlicht. Wie ging es Ihnen, als Sie sie mit dem zeitlichen Abstand noch mal zu einem Buch zusammenbrachten?
Ich habe mich im November erneut ans Schreiben gemacht. Das war früh so geplant. Es sollte ein Postscriptum geben, ein Weiterschreiben nach einer Unterbrechung, eine Rückbetrachtung, die dann aber gar nicht zurückschaute, sondern eher nach vorne. Das war enorm wichtig für das ganze Journal, denn so konnte ich die amerikanischen Wahlen noch reflektieren. Das war ja eine echte Zäsur im Jahr 2020, die unter der Pandemieglocke schon fast wieder vergessen ist. Und dann kam im November schon die zweite Welle. Diese Verlängerung des Journals zum Ende des Jahres hat es noch mal sehr verändert.
Web-Auftritt von Carolin Emcke
Im ersten Eintrag heißt es: »Jetzt rückt sie vor, die Epidemie, Region für Region, und erteilt uns eine Lektion in Demut.« – Gerade befinden wir uns wieder im Lockdown, die Situation ist durch Mutationen ernster als vor einem Jahr. Ist sie noch da, diese Demut? Vielleicht sogar die Hoffnung auf ein besseres Morgen, eine Läuterung der Menschheit durch die Pandemie? Oder bleibt nur Trotz und ein Urlaub auf Mallorca?
Sehr gute Frage. Im Moment ist mir die Demut und die Geduld wirklich abhandengekommen. Ich finde das Zögern, das kontra-faktische Hoffen der Ministerpräsident:innen wirklich unverantwortlich. Während die vor sich hin träumen, steigen die Infektionszahlen, die neue Mutante breitet sich immer weiter aus und es wird immer schwerer, sie zu kontrollieren. Ich verstehe diese Realitätsverweigerung nicht. Es war nun ein Jahr Zeit zu lernen, wie Modellierungen funktionieren, wie Wenndann-Funktionen funktionieren – und trotzdem wird da von Lockerungen geredet, anstatt radikal runterzufahren. Es bezahlen alle den Preis dafür. Psychisch, sozial, ökonomisch. Im Moment bin ich deswegen wenig zuversichtlich, dass die vielfältigen Lehren aus der Pandemie, die auch für die andere Krise, die des Klimas, so dringend notwendig wären, gezogen werden. Wir werden da gegen die Erschöpfung argumentieren müssen, gegen die Regression ins »Früher«. Ein Weiter-so oder eben eine Rückkehr zu früher darf es aber nicht geben. Wie wichtig das Denken in der Währung Zeit ist, hat uns die Pandemie vorgeführt. Das gilt es auch für die ökologisch-soziale Transformation zu bewahren. Wir müssen lernen, dass wir mit ängstlichem Zögern nicht nur Zeit verlieren, sondern auch die Schäden, Versehrungen und Kosten immer größer werden. Es braucht nicht nur Mut, sondern auch Lust auf radikale Veränderungen. ||
CAROLIN EMCKE: JOURNAL
S. Fischer, 2021 | 272 Seiten | 21 Euro
Das könnte Sie auch interessieren:
Schamrock-Festival 2024: Conference of the Birds
Walter Trier: Ausstellung in der Internationalen Jugendbibliothek
Thiemo Strutzenberger: Der Residenztheater-Schauspieler im Porträt
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!
Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.
Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.
JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton




