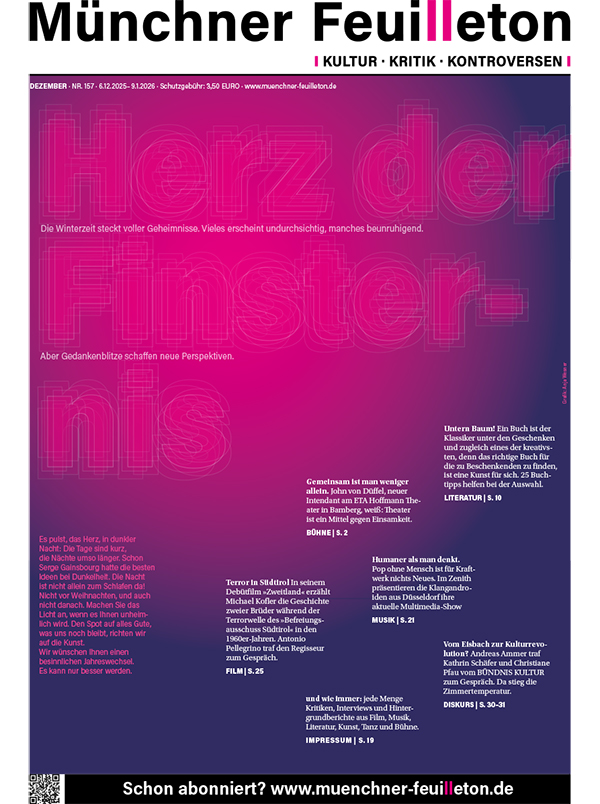»Bayerns größter Kunstevent für zeitgenössische Kunst« – so bewirbt sich die ARTMUC selbst auf ihrer Homepage. Dorian Ertl hat nachgefragt, was diesen Superlativ rechtfertigt.

Kristina Kanders: »Housewife 64, Eva« | 2017 | Öl auf Tapete auf Holz| © Kristina Kanders
Von 9. bis 11. November findet auf der Praterinsel wieder die ARTMUC statt. Schwerpunkte in diesem Jahr: Im Kunstraum João Carvalho präsentiert Carvalho selbst zusammen mit vier weiteren portugiesischen Künstlern verschiedene Kunstwerke und Installationen. Unter dem Titel »Emerging Galleries aus München« stellt sich die Galerie Frey aus Germering vor, die 2014 von Martina Frey gegründet wurde. Außergewöhnlich sind vor allem die wechselnden Ausstellungsszenarien in den Galerieräumen, die Spielarten von Werkschauen im »Industrielook« bis hin zur »kleinparzelligen Wohnzimmeratmosphäre« erlauben. Ein Sonderprojekt ist die Multimediainstallation von Studierenden der HFF München im ehemaligen Atelierhaus auf der Praterinsel. Insgesamt sind 80 nationale und internationale Künstler und 15 Galerien aus Europa an der Messe beteiligt.
Raiko Schwalbe, Initiator und Geschäftsführer der Messe, teilt in der Presseinformation mit: »Die Idee der ARTMUC wächst weiter und will zukünftig im jungen und dynamischen Kunstmarkt noch fokussierter neue, außergewöhnliche Trends aufzeigen und setzen und jungen Künstlern den Zugang zu einem breiteren Publikum ermöglichen. Mit ihren zwei Ausgaben pro Jahr (Frühjahr/Herbst) soll die ARTMUC als wichtigster Kunstevent der Stadt München weiter ausgebaut und gestärkt werden, mit dem Ziel, sich bis 2024 zur wichtigsten Plattform für zeitgenössische Kunst in Bayern und darüber hinaus zu entwickeln. Ziel ist es dabei, nicht nur in der Kunstmetropole München eine noch bessere Verzahnung zwischen Institutionen, Sammlern, Künstlern und einem interessierten Publikum zu schaffen, um so speziell dem künstlerischen Nachwuchs die ersten Schritte in eine breite Öffentlichkeit zu erleichtern.«
Das klingt mehr als ambitioniert. Wer ist dieser Raiko Schwalbe? Der gebürtige Berliner, Wirtschaftsinformatiker und Galerist erzählt: »Seit über 20 Jahre lebe ich nun schon in München. Ich habe noch einen Bruder und eine Schwester, die auch Berliner sind, aber noch in Berlin wohnen. 2006 habe ich damals mit meinem Bruder meine erste Galerie aufgemacht in Kreuzberg. Wir waren damals wirklich die erste Galerie in Deutschland, die das Thema Graffiti-Art, Street-Art auch so bisschen gezeigt hat. Das war zu der Zeit, als es in Berlin fast 750 Galerien gab: Es gab damals einen ganz, ganz schlimmen Boom, und alle wollten nach Berlin, damals war Berlin ir gendwie cool. 2008 veranstalteten wir wir eine Ausstellung, eine illegale Ausstellung – ›Kunst im Tresor‹ – im alten Landeszentralbankgebäude. Illegal deshalb, weil der Tresor keinen Notausgang hatte. Und trotzdem standen 1400 Leute an, um die Vernissage zu besuchen. Daraus ist dann auch die STROKE entstanden, die jetzt zum zehnten Mal stattfindet. Wiederum entwickelte sich die Idee der ARTMUC aus der STROKE. Wir wollten etwas Neues schaffen, vor allem da der Platzmangel, bzw. ein be zahlbarer Platz für die Kunst, gerade in München ein nie endendes Thema ist.«

Wechselte von Hannover nach Müchen – Elica Tabakova: Strich ins Leere | Mixedmedia, 70 x 100 cm | © Elica Tabakova
Wie steht er zum ewigen Dilemma von Kunst und Kommerz? Gleicht der Name »Präsentationsplattform mit Verkaufscharakter« nicht mehr einem Wahlslogan der FDP, als einer Kunstausstellung für zeitgenössische Kultur? »Ich stelle mich nicht hin und sage, ich bin der große Förderer, sondern ich bin Verkäufer«, so Schwalbe. »Wir sind ganz klar eine Präsen tationsplattform mit Verkaufscharakter. Es ist sogar so, dass ich selbst keine Künstler anschreibe – ich erweitere meine Datenbasis nicht –, sondern bekomme Anfragen von den Künstlern, damals regional, jetzt europaweit. Aufgrund der hohen Nachfrage findet die ARTMUC deshalb seit 2017 auch nicht mehr nur einmal, sondern gleich zweimal im Jahr statt. Diesen Mai hatten wir sogar zwei Locations, Isarforum und Praterinsel.« Was hat Raiko Schwalbe für eine Ausbildung? Ist er Sammler? Oder selbst Künstler? »Ich bin BWL Informatiker. Zwischen 2008 und 2011 habe ich angefangen Kunst zu kaufen, dann wieder aufgehört, weil ich aufgrund der Netzwerke jeden Tag un endlich viele Bilder kaufen könnte, wenn ich nur wollte. Ich fange aber jetzt seit ein, zwei Jahren wieder an Bilder zu kaufen, die mir gefallen.«
Schwalbes Offenheit bei der ARTMUC Konzeption gibt der Messe einen betont jugendlichen Anstrich. In einem Interview sagte er, die ARTMUC sei eine Messe ohne ein Symposium oder eine Eröffnungsrede des Bürgermeisters, also fern von allem Konservativen. Dient dieser unkonventionelle, liberale Appeal dazu, die Jugend mit der Kunst in Berührung zu bringen, oder ist das einfach gutes Marketing? »Vor allem die STROKE ist stark jugendlich geprägt. Bei der ARTMUC hingegen liegen wir in der Zielgruppe von 20 bis 25 Jahren. Aber ja, natürlich haben wir auch jährlich viele Schulklassen zu Besuch. Und ja, es gibt auch junge Käufer! Viele junge Leute, die früher zwei, drei Euro ausgegeben haben, weil sie mal kein Ikea-Poster kaufen wollten, sieht man heute auf Galerien. Die ARTMUC ist dafür da, dass man reinkommt und frei sagen kann: Das gefällt mir, das gefällt mir nicht!«
Haben junge Künstler eine Chance auf einen Ausstellungsplatz? »Auf jeden Fall! Wir haben bei der ARTMUC ab sichtlich keine Altersgrenze festgelegt und vergeben je des Jahr vier, fünf, sechs Greencards an junge Künstler.« Geht es nun ums Geld oder um die Kunst? Geht es bei der ARTMUC um die Menschen, um die Jugend, oder geht es um die Käufer? »Wir sollten in der Realität bleiben. Wir haben Künstler, die, wie jeder normale Mensch auch, Geld, Kleidung, Nahrung brauchen. Wo sollen sie denn sonst ihre Werke ausstellen, wenn nicht auf Kunstausstellungen mit Verkaufscharakter? Die Künstler bräuchten einen Mäzen, aber da sind wir dann schon in einem anderen Feld. Denn für einen Kunstmäzen brauchst du in den meisten Fällen einen hohen Bekanntheitsgrad oder gute Verbindungen. Auch Künstler müssen sich ihr Brot verdienen können. Die ARTMUC bietet all das: Verkauf, Ausbau der Präsentationsmöglichkeiten, Netzwerk unter den Künstlern stärken. Künstler müssen in unserer Zeit kommerziell agieren.«

Die Meisterschülerin von Marko Lehanka in Nürnberg, ausgezeichnet mit dem Fränkischen Kunspreis, arbeitet jetzt im Domagkatelier – Isabel Ritter: »Standbild #1«| 2014 | Eiche, Eitempera, 58 x 42 x 24 | © Isabel Ritter
Raiko Schwalbe ist kein klassischer Kunstidealist. Eher ist er ein Wirtschaftsrealist. Die Zahlen sprechen für ihn und seine Messen: 20.000 Besucher auf der STROKE, 14.000 Besucher auf der ARTMUC, wachsende Ausstellerlisten, wachsende Umsätze. Dass die ARTMUC kein Kraut-und-Rüben-Kunstmarkt ist, sichert die Jury, der die Künstlerin und Kuratorin Dörthe Bäumer, die Galeristin Karin Wimmer, die Unternehmerin Uta Römer, die Kuratorin Anna Wondrak und Guido Redlich von der Stiftung Pinakothek der Moderne angehören. Sie wählen die Künstler aus, und Raiko Schwalbe zeigt, wie man mit Kunst Geld verdienen kann. Warum da die städtischen Zuständigkeiten im Bereich Kreativwirtschaft noch nicht auf die Idee gekommen sind, ihn als Berater zu engagieren, weiß niemand. ||
ARTMUC
Praterinsel 3–5| | 9.–11. November | Fr / Sa 12–20 Uhr, So 12–18 Uhr
Das könnte Sie auch interessieren:
Der digitale Impressionist: Immersive Ausstellung von Miguel Chevalier in der Kunsthalle München
Mehr als ein Spielplatz: Ausstellung im Haus der Kunst
Löwenstark und papageienbunt
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!
Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.
Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.
JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton