Ein Gespräch mit dem Publizisten Robert Misik anlässlich seines Buches »Liebe in Zeiten des Kapitalismus«.

Robert Misik| © Ingo Pertramer
Herr Misik, leben wir in solch nüchternen Zeiten, dass denn trotz gesellschaftlicher Aufgeregtheit für Utopien kein Platz ist? Es scheint, wie es der slowenische Philosoph Slavoj Žižek nahelegt, als könnten sich viele Menschen den Untergang unseres Planeten eher vorstellen als das Ende des Kapitalismus. Warum ist die Lage so verfahren?
Die großen progressiven Utopien sind stark aus der Mode gekommen, weil man erkannt hat, dass sie teilweise illusionär waren. Historische Erfahrungen zeigen außerdem, was sie anrichten können. Daher ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Eine Ernüchterung, die eine Zeit lang selbst als Fortschritt gefeiert wurde. Man hat die vernünftige Ernüchterung nicht nur hingenommen, sondern auch heroisiert. Das Ergebnis ist, dass es große politische Energien nicht mehr gibt, denn die hängen von einem Ansporn ab, ein großes Ziel oder auch das Unmögliche zu erreichen. Diese Utopielosigkeit schlägt am Ende in Hoffnungslosigkeit um und produziert ihre eigenen Gespenster.
Wie sehen diese Gespenster aus?
Wo die Utopie verloren geht, geht am Ende auch Hoffnung verloren, Angst frisst sich in Gesellschaften hinein und zudem ist politische Passivität die Folge, denn wofür soll man sich einsetzen, wenn große Ziele nicht mehr im Angebot sind?
Utopische Projekte haben früher die Wunschvorstellungen und die politische Willensbildung kanalisiert. Man konnte gemeinsam an etwas glauben. Profitiert der Populismus – auch ein Symptom des gegenwärtigen Kapitalismus – von dieser inhaltlichen Leerstelle?
Natürlich profitieren Populisten davon, weil die Progressiven mangels ambitionierter Projekte nur noch ausstrahlen: Wir können nichts tun. Und wenn wir etwas tun können, dann können wir nur dafür sorgen, dass die Dinge sich langsamer zum Schlechten entwickeln – das ist keine besonders elektrisierende Botschaft. Damit frisst sich Angst in unsere Gesellschaft hinein. Diese Angst wiederum ist das Wasser auf die Mühlen der Populisten. Sie ist wahrscheinlich noch deutlich größer, als wir annehmen. Jeder hat Angst vor irgendwas. Die gerade noch einigermaßen Erfolgreichen, die ausstrahlen, dass sie ihr Leben und ihre Karrieren im Griff haben, sind davon angesteckt, weil es natürlich ein permanent prekärer Zustand ist, in dem sie stecken. Der kleine Erfolg, die kleine Stabilität, die ich heute genieße, kann morgen schon nicht mehr da sein. Dieses Gefühl, diese Angst greifen Populisten auf.
Wenn es um die Argumentation gegen Populisten und gegen rechts geht, bringen Progressive zuverlässig die Ratio in Stellung. Die Aufklärung soll herhalten gegen Wissensdefizite, politische Ignoranz und Intoleranz. So richtig funktioniert die Vernunftstrategie nur nicht, wie es die Erfolge der AfD, Trumps Republikaner und die FPÖ in Österreich zeigen. Ist es an der Zeit – wie es die Publizistin Isolde Charim in ihrem aktuellen Buch »Ich und die Anderen« nahelegt – an die politischen Emotionen zu appellieren und weniger an die Vernunft?
Man sollte logischerweise kein Plädoyer für die Unvernunft halten. Eine bestimmte Form der rationalen, faktenbasierten Argumentation wird man nicht aus der progressiven Geistesgeschichte raushalten können. Was aber auf jeden Fall stimmt, ist, dass der Aufbau von bestimmten Identitäten und politischen Bewegungen immer mit Emotionen verbunden ist. Mit der Etablierung eines Wir, eines Glaubens daran, dass eine bessere Gesellschaft möglich ist. Politische Bewegungen waren immer davon getragen, dass sie nicht nur Individuen versammelten, die aus rationaler Einsicht ein gemeinsames Ziel verfolgten, sondern diese Individuen waren durch ein Wir-Gefühl verbunden, es schwang da immer auch etwas mit, was eher ins Reich der Gefühle als ins Reich der Ratio ressortiert, und diese Individuen hatten dann auch eine gemeinsame Identität.
Sie schreiben, in Anlehnung an den Soziologen Heinz Bude, »die politischen Eliten umgarnen die Bürger nicht mehr mit positiven Versprechen, im Kapitalismus im Krisenmodus ist die Drohkulisse allgegenwärtig.« Wie genau sieht diese Drohkulisse aus und was macht sie mit der mentalen Verfasstheit von Bürgern?
Politische Integration findet nicht mehr durch das Formulieren positiver Versprechen, sondern nur noch durch implizierte oder explizierte Formulierung von Bedrohungsszenarien statt. Indem man den Leuten Angst macht: Wenn du als Einzelner nicht spurst, wirst du scheitern. Wenn wir zusammen nicht den Gürtel enger schnallen und ökonomische Härten akzeptieren, dann ist der Standort gefährdet oder das Unternehmen. Wir sind permanent umstellt von Drohgeschichten und nicht mehr von Hoffnungserzählungen. Das etabliert auch diese Art Angst, von der ich vorher gesprochen habe.
Von dieser kapitalistischen Drohkulisse können vor allem einige Länder im Süden Europas ein Lied singen. Interessant sind hierbei die Narrative, die das herrschende System von sich selbst produziert. Während der Griechenlandkrise etwa herrschte in Deutschland medial der Tenor: Die faulen Griechen gefährden mit ihrer Schuldenpolitik die EU, daher müssen sie diszipliniert werden. Wies man Kommentatoren auf Unstimmigkeiten und Pauschalisierungen in ihrer Argumentation hin, wurden sie schnell richtig grantig und schrieben sich noch mehr in Rage. Das hatte fast etwas Pathologisches. Wie kommt es zu solchen Erzählungen?
Das Interessante an solchen Erzählungen ist, dass sie nicht als moralische Erzählungen erscheinen, sondern so tun, als hätten sie die ökonomische Rationalität auf ihrer Seite. Das heißt, man muss sich nur wirtschaftlich vernünftig verhalten. Vernünftig heißt sparen und bereit sein, ökonomische Härten auf sich zu nehmen, weil das in Zukunft angeblich positive Ergebnisse zeitigt. Dies wird im Tonfall einer kühlen, nüchternen Abgeklärtheit formuliert, aber in Wirklichkeit ist es natürlich eine zutiefst moralische Erzählung: Jemand, der scheitert, ist selber schuld. Ökonomien, die in die Krise geraten, sind selbst schuld, weil sie vorher über ihre Verhältnisse gelebt haben. Damit ist es innerhalb dieser Logik moralisch gerecht, sie zu bestrafen. Was wir immerzu übersehen, ist, dass jede Art ökonomischer Argumentation in dem Moment, wo sie von Schulden und Verbindlichkeit spricht, eine moralische Erzählung ist. Da schwingt natürlich immer schon der moralisch konnotierte Begriff der Schuld selbst mit.
Unter der zunehmenden Individualisierung und Auflösung der klassischen Milieus haben die Volksparteien in den letzten Jahren gelitten – vor allem die sozialdemokratischen. Was haben sie falsch gemacht? Wie müsste ihre inhaltliche Erneuerung aussehen, um die Wähler zurückzugewinnen?
Durch die Individualisierung haben es diese Parteien heute schwer, weil sich ihre klassischen Milieus in Submilieus zerlegen. Und weil es keine Anrufung mehr an den Einzelnen gibt, Teil einer gemeinsamen sozialen Bewegung zu sein. So richtet sich diese Anrufung nur mehr an den Einzelnen als Individuum: Sei ein Individuum, schließ dich nirgendwo an und mach dein Ding. Andreas Reckwitz nennt das die »Gesellschaft der Singularitäten«, aus der eine »Krise des Allgemeinen« folgt, die aber, wie ich hinzufügen würde, natürlich auch die Einzelnen überfordert. Wir wollen alle zusammen nicht jeden Tag einen Kampf aller gegen alle, bei dem wir nur auf uns gestellt sind, nicht eingebettet in soziale Verflechtungen und nicht gestützt von den Fäden des Gemeinsamen. Die andere Geschichte ist, dass die Sozialdemokraten politisch immense Fehler gemacht haben. Ihre Pragmatisierung hat dazu geführt, dass ein Denken über das Aktuelle hinaus plötzlich als blauäugig utopisch dargestellt wird. Jede Ambition ist aus den Wahlprogrammen der Sozialdemokraten und Mitte-links-Parteien verschwunden. Sie haben sich auch allein optisch dem restlichen politischen Milieu angepasst. Das erweckt den Eindruck, dass auch sie Teil der globalen Superklasse und ökonomischen Macht geworden sind. Wenn die politische Linke aber in Zeiten eines wild gewordenen globalisierten Kapitalismus den Eindruck erweckt, dass man den Kapitalismus eh nicht zähmen kann und sie eigentlich selbst gerne Teil der ökonomischen Supermacht werden will, dann verliert sie jede Glaubwürdigkeit.
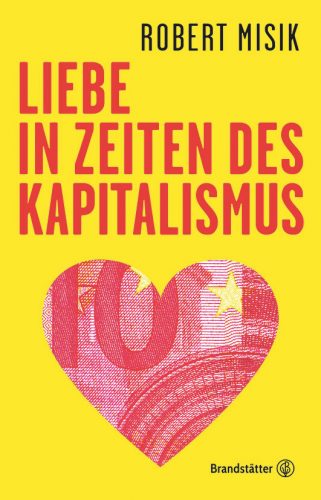
In aktuellen gesellschaftlichen Debatten dominieren identitätspolitische Argumentationen. Auf der politisch konservativen und rechten Seite kreisen die Obsessionen um nationale Identität – wer gehört zum Land dazu und wer nicht? Im linken Lager ist der Diskurs beherrscht von Fragen der Identity Politics. Geschlechtergerechtigkeit, Gender-Theorien, ethnische Beziehungen. Viele Kritiker sagen nun, über die Subjektivität betreffende Fragen dürfe man universalistische Anliegen wie allgemeine Gerechtigkeit nicht aus den Augen verlieren. Spielt diese Argumentation Identitätspolitik und Universalismus unzulässig gegeneinander aus?
Ganz gewiss ist das eine unsägliche Dichotomie. Sigmar Gabriel hat die These aufgestellt, dass die Sozialdemokratien zu »postmodern« geworden seien, also sich zu viel um Feminismus und Schwulenrechte gekümmert haben und zu wenig um den ausgebeuteten Postzusteller, die Verkäuferin oder den Kohlegrubenarbeiter. Meine Antwort darauf: Vergesst diesen Unfug. Sozialdemokratien oder Linksparteien, die glaubwürdig sind, sind in beiden Milieus glaubwürdig, in den liberal-urbanen und in den (post-) proletarischen, und wenn sie unglaubwürdig sind, sind sie es auch in beiden. Außerdem, was soll das denn heißen? Dass man wichtige Kämpfe um Rechte von Einzelnen nicht führt, nur um irgendjemanden nicht zu verschrecken? Es ist doch absurd. Die Antwort der Linken muss immer sein: Wir gewinnen diesen Kampf gemeinsam, oder wir verlieren ihn auch gemeinsam. Übrigens ist mir auch noch kein Stahlarbeiter untergekommen, der findet, dass sich die sozialdemokratischen Parteien zu sehr um die Rechte von Schwulen oder Transpersonen engagieren, und der jetzt nicht mehr links wählt, weil die Linken sich für eine dritte Toilette für Transgenderpersonen einsetzen. Keiner würde sagen: Ich wähle euch nicht mehr, weil ihr euch für diese Dinge einsetzt. Er würde allenfalls sagen: Ich wähle euch nicht mehr, weil ihr euch nur mehr für diese Dinge einsetzt, aber für mich interessiert ihr euch nicht einmal. Und das ist doch etwas erheblich anderes.
Horcht man hinein in unsere Gesellschaften, hört man bei sehr vielen Menschen den Unmut über die aktuellen Zustände heraus. Dennoch scheinen genuin linke Positionen nicht mehrheitsfähig. Muss die Kapitalismuskritik ihre Kommunikationsformen überdenken? Es gibt ja derzeit Kritiker wie die philosophische Strömung des Akzelerationismus, die meinen, mit bräsigen Entschleunigungs-Beschwörungen kämen wir nicht voran, was wir bräuchten, wäre sogar noch mehr Beschleunigung und ein Bejahen der kapitalistischen Produktionskräfte.
Zunächst einmal muss klar sein, dass man als Progressiver mit einer reinen Verzweiflungs- und Angstgeschichte nicht weiterkommt. Es ist der falsche Ansatz zu sagen: Wehren wir uns gegen die Beschleunigung, Automatisierung und Digitalisierung, wehren wir uns gegen die Entfesselung der Produktivkräfte. Eigentlich war es immer die Haltung der Linken zu sagen: Es ist toll, dass uns die Maschinen die Arbeit abnehmen; es ist toll, dass sich die Produktivität entwickelt und dass es einen potenziellen Reichtum für alle gibt. Es geht halt am Ende nur darum, gerecht zu verteilen, und darum, die Art und Weise, wie produziert wird, zu prägen, um die Kontrolle über die Produktivkräfte zu erlangen. Eine Art optimistischer Zukunftsgeschichte braucht die Linke schon. Das wäre auch etwas, das Menschen wieder begeistern und wofür man sich gemeinsam einsetzen könnte. ||
ROBERT MISIK:LIEBE IN ZEITEN DES KAPITALISMUS
Christian Brandstätter Verlag,
2018 | 208 Seiten 19,90 Euro
Das könnte Sie auch interessieren:
Buchtipps: Jen Beagin, Salman Rushdie, Grethe Bøe
Diözesanmuseum Freising: Wiedereröffnung mit neuer Ausstellung
»Luisa Miller« am Gärtnerplatztheater
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!
Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.
Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.
JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton




